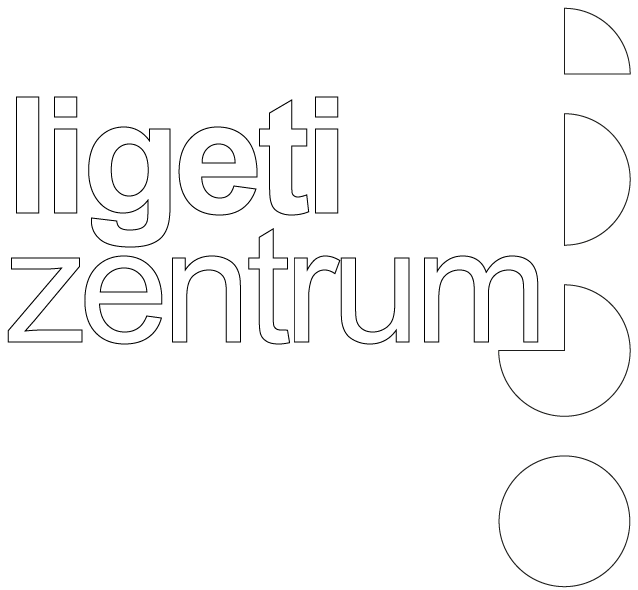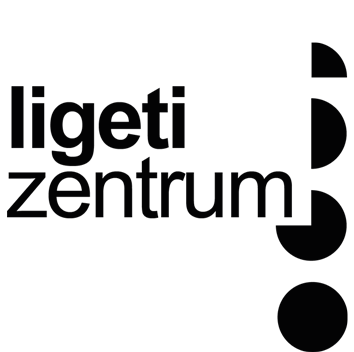„transformation“: Musik, Improvisation und Film im Kohlekraftwerk
Am 8. Mai 2025 ist es soweit: „transformation“, ein explorativer Film des HOOU-Projekts WATTwanderungen und des SPIIC+ Ensembles, feiert Premiere im ligeti zentrum. Auch in den kommenden Monaten soll der Film an unterschiedlichen Locations und in verschiedenen Settings zu sehen sein. Interview zum Filmstart mit den leitenden Köpfen, Axel Dürkop und Vlatko Kučan
Film ab: Eine mysteriöse Gruppe von fünf Protagonist:innen betritt einen surreal anmutenden Ort und begibt sich auf eine scheinbar rituelle Exploration. Was ist das für ein Ort? Ein ferner Planet? Eine düstere Zukunftsvision unserer Erde? Wer sind die Akteur:innen? Wissenschaftler:innen? Schaman:innen? Mythische Wesen? Mit Musik, Improvisation und den Mitteln der künstlerischen Forschung wirft der explorative Film „transformation“ nicht nur die dringlichen Fragen unserer Zeit auf – er entführt sein Publikum zugleich an einen Ort, der in der festgehaltenen Form schon heute nicht mehr existiert: das Kohlekraftwerk Moorburg.
2007 an den Platz des 2004 abgerissenen Gaskraftwerks Moorburg getreten, war das KKW Moorburg im Hamburger Süden bis in den Dezember 2020 in vollem Betrieb. Im Juli 2021 stillgelegt, begannen im März 2025 schließlich die Abrissarbeiten. Dass das Projekt WATTwanderungen Moorburg im Rahmen seiner Bildungserlebnisse zu erneuerbaren Energieorten rund um Hamburg einen Besuch abstatten würde, lag auf der Hand. Ein neuer Twist entstand nun durch das für Improvisation bekannte SPIIC+ Ensemble (ArtSearch Lab) – und die Entscheidung von Axel Dürkop und Vlatko Kučan, das gebotene Setting für einen explorativen Film zu nutzen.

ligeti zentrum: Musiker:innen, Kameraleute, Organisator:innen und Mitwirkende in einem stillgelegten Kohlekraftwerk… Wie entstand die Idee für das Filmprojekt „transformation“?
Axel Dürkop: Im Rahmen einer Preisverleihung für die WATTwanderungen entstand ein Kontakt nach Moorburg und sofort war der Wunsch da, dort etwas Künstlerisches umzusetzen. Eine Weile kursierte die Idee, dort das Musical „Hair“ aufzuführen – wegen Aquarius und Wasserstoff, der zukünftig angestrebten Energieerzeugung in Moorburg. Wir fanden einen engagierten Unterstützer vor Ort, der nicht nur Verständnis für unsere künstlerischen Ambitionen aufzeigte, sondern selbst der Meinung war, dass man im Kohlekraftwerk doch mal ein Musical spielen müsste.
Etwas realistischer verfolgten wir zunächst den Plan eines Chorkonzertes. Durch die wunderbare Akustik hätte man im Kohlekreislager sicherlich auch singen können. Ein Konzert mit 200 Chormitglieder:innen und 200 Zuschauer:innen wäre letztlich aber schlichtweg zu aufwendig und exklusiv geworden. Während all dieser Überlegungen waren Vlatko und ich bereits im Gespräch, weil wir schon lange den Wunsch hegten, ein gemeinsames Projekt umzusetzen.
Vlatko Kučan: Schon vor zwei Jahren dachten wir erstmals über ein gemeinsames Film-Musik-Projekt nach. Auch im Rahmen des angedachten Chorkonzertes im Kohlekreislager spielten wir mit der Idee, zwei Chöre mit dem SPIIC+ Ensemble zu kombinieren. Als dafür schließlich die Absage kam, überlegten wir weiter: ‚Lass uns da rein, wir könnten was dokumentieren, vielleicht auch mit einem Kamerateam.‘ Aufgezeichnete Performances ohne Publikum kennen wir alle aus Covid-Zeiten. Das war also eine Option, die wir beide als nicht so spannend empfanden. Relativ schnell entwickelten sich der Ideenfluss und die gegenseitige Inspiration in Richtung eines transdisziplinären Projekts – keine Konzertdokumentation ohne Publikum und auch kein Musik-Clip, sondern ein Film. Das Genre würde sich im Laufe unserer Arbeit herauskristallisieren.
Transformation ist Veränderung mit einem Ziel.
Veränderung passiert, Transformation gestaltet.
Transformation heißt, eine Haltung zur Veränderung zu entwickeln.
Transformation improvisiert, Transformation nutzt den Irrtum, Transformation lernt.
ligeti zentrum: Was bedeutet Transformation in diesem Kontext?
Axel Dürkop: Der Film heißt „transformation“, weil er im Konzept der WATTwanderungen der Startpunkt für einen Reflektionsgang um den Ort Moorburg darstellt. Da wurde Kohle verstromt, jetzt soll dort Wasserstoff produziert werden. Durch den Wandel findet Transformation in Moorburg somit auf unterschiedlichen Ebenen statt: an dem Kraftwerk und seinen Gebäuden, aber auch in den Menschen selbst, die rund um das Kraftwerk leben und dort arbeiten. Was die Energiewende mit Menschen macht, finde ich persönlich sehr spannend.
Vlatko Kučan: Der transformative Erneuerungsprozess – ein Abschied von den fossilen Energien hin zum Wasserstoff – diente uns als Ausgangspunkt. Aber wir wollten ganz bewusst keinen pädagogischen Film drehen, sondern einen künstlerischen. Was daraus entstand, ist nicht zuletzt diesem unwirklichen Ort selbst zu verdanken.

ligeti zentrum: Wie muss man sich so ein stillgelegtes Kohlekraftwerk, das kurz vor dem Abriss steht, vorstellen?
Vlatko Kučan: Ich kann mich noch gut an meinen ersten Eindruck erinnern. Man kommt mit einer gewissen Vorstellung auf eine so große Anlage. Aber die Dimensionen sind wirklich ganz andere, wenn man sich auf dieses Gelände – ein Konglomerat von großen bis gigantischen Gebäuden – begibt. Natürlich gibt es Vorkehrungen rund um den Hochsicherheitsbereich und man kann da nicht einfach rein und raus. Es ist wie eine Station auf einem Planeten, die autark funktioniert.
Wir filmten in einem der beiden Kohlebunker, die früher voll mit Kohle waren, um ganz Hamburg mit Strom zu versorgen. Die Kohleschiffe legten an einem riesigen Dock an, von dem die Kohle befördert wurde.
Axel Dürkop: In dem Kohlekreislager gab es für unseren Dreh keine Infrastruktur mehr, auch keinen Strom. Das bedeutete, dass wir alles mitbringen mussten, was wir zum Filmen brauchten. Zum Glück hatten wir die Möglichkeit, vor dem Dreh ein paar technische Eckpunkte festzuziehen. Wir mussten herausfinden, ob die Beleuchtung ausreichen würde, in 4K ein artefaktfreies Bild zu filmen. Mehrere Kolleg:innen im Kraftwerk hatten viel Spaß an dem Projekt und machten vieles möglich, was wir sonst vielleicht gar nicht bekommen hätten: Strom und industrietypische Leuchtmittel zum Beispiel. Da wir die Industrieruine quasi so bespielten, wie wir sie vorfanden, hielt sich der organisatorische Aufwand darüber hinaus vergleichsweise in Grenzen.
Mehrere Kolleg:innen im Kraftwerk hatten viel Spaß an dem Projekt und machten vieles möglich, was wir sonst vielleicht gar nicht bekommen hätten: Strom und industrietypische Leuchtmittel zum Beispiel
ligeti zentrum: Das SPIIC+ Ensemble zeichnet sich vor allem durch die gemeinsame Improvisation seiner Musiker:innen aus. Lässt sich dasselbe Maß an Exploration auf einen Film übertragen?
Axel Dürkop: Was technische Experimente anbelangt, haben wir versucht, vieles zu entkoppeln und vorzulagern, um an den zur Verfügung stehenden Tagen mit drei Kameras wirklich die verabredeten Shots aufzunehmen. Schon im Rahmen der planerischen Begehungen stieß Leonie Sens zum Team dazu. Sie machte entsprechend unseres Narrativs Vorschläge für eine Strukturierung und begleitete uns mit einer klaren künstlerischen Vorstellung bis in die Postproduktion. Durch die Kombination mit der Musik erzählen wir keine klassische Geschichte mit Figuren.
Vlatko Kučan: Trotz des Drehbuchs und einer gewissen Vorstellung dessen, was wir vorhatten, arbeiteten wir mit dem Wissen, dass die zur Verfügung stehende Zeit nicht ausreichen würde. Viele Perspektiven wurden parallel mit mehreren Kameras gedreht und wir arbeiteten unsere Checkliste ab; vor Ort hatten wir aber nicht die Zeit, das Material zu sichten. Dahingehend sind später ganz tolle, auch ungeplante Sachen entstanden.
In der musikalischen Gestaltung setzten wir ganz im Sinne von SPIIC+ keine vorher festgelegten Kompositionen um, sondern arbeiteten in dem Spannungsverhältnis von Idee und Exploration – auch im unmittelbar praktischen Sinne. Man ist vor Ort und sagt: ‚Ich könnte da rauf gehen.‘ Das kann eine Viertelstunde Klettern bedeuten, um dann auf einer 50 Meter hohen Balustrade zu landen. Diese spontanen Aktionen waren besonders reizvoll.
Axel Dürkop: Wir haben den musikalischen Momenten ganz bewusst viel Raum gegeben – besonders in den Ensembleszenen, in denen Musiker:innen gemeinsam improvisierten. So arbeitet das SPIIC+ Ensemble ja. Aus einer beobachtenden Sicht zu sehen, was dabei herauskommt, ist immer eine Überraschung.
Vlatko Kučan: Dieser Prozess des aktiven Suchens ist entscheidend. Für viele haftet der Improvisation noch immer etwas Beliebiges an – wie eine Art Trial-and-Error. Aber das trifft es gar nicht. Es ist vielmehr ein Nachspüren von Atmosphären, von Interaktionen, von gemeinsamen Ideen, die sich dann im Klang, in der Musik manifestieren. Künstlerische Improvisation ist kreative Kokreation – das Künstlerische und das Soziale sind darin untrennbar miteinander verwoben.
Der transdisziplinäre Aspekt, zwei so unterschiedliche Kunstformen miteinander ins Gespräch zu bringen, war für mich besonders spannend. Während die musikalische Improvisation im Augenblick, im Jetzt der Akteure, lebt, fließt in die Filmkunst verdichtete Lebenszeit vieler Beteiligter ein. Wie viele Menschen an „transformation“ mitgewirkt haben, wird letztlich auch in unserem Abspann deutlich, auch wenn wir unser Team so klein wie möglich gehalten haben.
Künstlerische Improvisation ist kreative Kokreation – das Künstlerische und das Soziale sind darin untrennbar miteinander verwoben
ligeti zentrum: Vor Ort arbeiteten zunächst 15 Personen, unter ihnen ein dramaturgisches Kernteam, Kamera- und Lichtleute sowie fünf Musiker:innen. Wie kam es zu dieser kompakten Verteilung?
Vlatko Kučan: Durch seine Größe und weil der Raum leer war, war es im Kohlekreislager hochakustisch. Jede Bewegung, die man machte, erzeugte ein Knistern. Das war generell schon eine Wahnsinnsherausforderung, vor allem aber während der Tonaufnahmen. Alle mussten absolut still sein. Vor Ort arbeiteten wir mit einem Minimum an Personal, was dafür sorgte, dass einige im Team mehrere Aufgaben übernehmen mussten.
Axel Dürkop: Das Team war insgesamt schon eng getaktet. Da alle am gleichen Strang zogen, gab es dennoch keine Reibungsverluste.

ligeti zentrum: Aufgrund der anstehenden Abrissarbeiten der Kraftwerkgebäude fielen die Drehtage auf ein Wochenende im Winter. Was bedeutete das für die Musiker:innen?
Vlatko Kučan: Die Temperaturen lagen während des Drehs nicht weit über dem Gefrierpunkt. Nachts hat es teils auch gefroren. Im Kohlekreislager war es kalt, klamm, dunkel und es war gefährlich, sich dort zu bewegen. Man konnte die Instrumente kaum festhalten. Wir waren richtig dick eingepackt und mussten Helme und Schutzwesten tragen. Das ist eine Situation, die Musiker:innen normalerweise tunlichst vermeiden würden.
Aber schon in den 60er-Jahren gab es in England eine bekannte Improvisationsgruppe, die eine Weile lang bewusst Konzerte im Winter und in unbeheizten Hallen spielte, um die Virtuosität aus ihrem Spiel zu verbannen. Sie wollten absichtlich unbequeme Situationen schaffen und mit kalten Fingern spielen. Wir haben uns das so nicht ausgesucht, aber diese Perspektive hat uns einen Weg eröffnet, die vorgefundenen Gegebenheiten als Möglichkeit zu betrachten: ‚Genau das ist jetzt der Raum – das ist die Atmosphäre, die Temperatur und die Welt, die uns hier entgegentritt und in der wir uns behaupten müssen.‘ Dem wollten wir uns bewusst stellen.
ligeti zentrum: Mittlerweile liegt der Dreh rund ein halbes Jahr zurück. Was hat sich seither in Moorburg getan?
Axel Dürkop: Erst wenn man selbst vor Ort ist, weiß man, was für unglaubliche Mengen von Material durch den Abriss und den Rückbau des Kohlekraftwerks bewegt werden wollen.
Interessant sind und bleiben das Dorf hinter dem Deich und die Menschen rund um den Verein, der seit Jahren Widerstand gegen den Betreiber des Kohlekraftwerks geleistet hatte. Mehrere Aktive haben dort eine beachtliche Photovoltaikanlage gebaut, mit der sie mittlerweile im elften Jahr das SWAMP Festival veranstalten. Unter dem Motto „Keine Kohle – trotzdem Strom“ wird das gesamte Festival mit vor Ort produziertem Solarstrom betrieben.
All diese Entwicklungen und die Energieformen in Moorburg – ehemals Steinkohle, währenddessen Solarenergie, in Zukunft Wasserstoff aus erneuerbaren Energien – finde ich persönlich sehr würdig, zu bearbeiten. Auch künstlerisch sind da einfach sehr viele Geschichten verborgen.
Mir ist daran gelegen, den Film dort zu zeigen, wo Menschen sich begegnen und austauschen. Das ist der Startpunkt für einen Transformationsprozess
ligeti zentrum: Wie geht es nach der Premiere weiter mit „transformation“?
Vlatko Kučan: Wir planen, den Film weiter und in anderen Kontexten zu zeigen. Das ist das Spannende: Im Kontakt mit dem Publikum wird er noch eine vollkommen andere Transformationsebene initiieren.
Axel Dürkop: Uns ist daran gelegen, den Film auf jeden Fall in Moorburg zu zeigen, um ihn auch als künstlerisches Artefakt für sich stehend zu sehen und zu genießen. Das ist mir bei den WATTwanderungen so wichtig: Dass man zusammenkommt. Die Gesellschaft braucht Miteinander, gemeinsames Handeln und Dialoge. Dieser Film kann, so meine Hoffnung, Fragen aufwerfen: ‚Was haben wir da gesehen? Was bedeutet das denn?‘ Der kollaborative Interpretationsprozess erlaubt es, voneinander zu lernen, Ansichten gegeneinander zu halten und daraus neue Schlüsse zu ziehen. Deshalb ist eine Online-Veröffentlichung in meinen Augen auch nicht mit einem Screening vergleichbar. Mir ist daran gelegen, den Film dort zu zeigen, wo Menschen sich begegnen und austauschen. Das ist der Startpunkt für einen Transformationsprozess.

Am 8. Mai 2025 feiert „transformation“ Premiere im Production Lab des ligeti zentrums. Informationen über weitere Spielstätten und Termine folgen in Kürze und werden im Veranstaltungskalender aufgeführt.